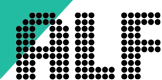Widerruft ein Darlehensnehmer ein vertraglich vereinbartes Verbraucherdarlehen, wird das Darlehen rückabgewickelt.
Dafür werden alle empfangenen Leistungen und Zinsen des Darlehensnehmers und des Darlehensgebers zunächst getrennt betrachtet. Die Leistungen, die der Darlehensnehmer bis zum Datum des Widerrufs erhalten hat, werden mit dem vertraglich vereinbarten Sollzins verzinst. Die Leistungen, die der Darlehensgeber bis zum Datum des Widerrufs erhalten hat, sind im Normalfall mit einem Verzugszinssatz in Höhe von Basiszinssatz + 5 % zu verzinsen. Handelt es sich um ein grundpfandrechtlich gesichertes Verbraucherdarlehen (Verbraucher-Immobiliardarlehen), wird mit einem Verzugszinssatz in Höhe von Basiszinssatz + 2,5 % gerechnet. Am Ende werden die beiden Endbeträge gegeneinander aufgerechnet. Das Ergebnis ist der vom Darlehensnehmer abzulösende oder der vom Darlehensgeber zu zahlende Betrag.
Kategorie: Finanz Lexikon
ALF-Lexikon
Darlehenswiderruf
Widerruft ein Darlehensnehmer ein vertraglich vereinbartes Verbraucherdarlehen, wird das Darlehen rückabgewickelt.
Dafür werden alle empfangenen Leistungen und Zinsen des Darlehensnehmers und des Darlehensgebers zunächst getrennt betrachtet. Die Leistungen, die der Darlehensnehmer bis zum Datum des Widerrufs erhalten hat, werden mit dem vertraglich vereinbarten Sollzins verzinst. Die Leistungen, die der Darlehensgeber bis zum Datum des Widerrufs erhalten hat, sind im Normalfall mit einem Verzugszinssatz in Höhe von Basiszinssatz + 5 % zu verzinsen. Handelt es sich um ein grundpfandrechtlich gesichertes Verbraucherdarlehen (Verbraucher-Immobiliardarlehen), wird mit einem Verzugszinssatz in Höhe von Basiszinssatz + 2,5 % gerechnet. Am Ende werden die beiden Endbeträge gegeneinander aufgerechnet. Das Ergebnis ist der vom Darlehensnehmer abzulösende oder der vom Darlehensgeber zu zahlende Betrag.
Rückabwicklung
Widerruft ein Darlehensnehmer ein vertraglich vereinbartes Verbraucherdarlehen, wird das Darlehen rückabgewickelt.
Dafür werden alle empfangenen Leistungen und Zinsen des Darlehensnehmers und des Darlehensgebers zunächst getrennt betrachtet. Die Leistungen, die der Darlehensnehmer bis zum Datum des Widerrufs erhalten hat, werden mit dem vertraglich vereinbarten Sollzins verzinst. Die Leistungen, die der Darlehensgeber bis zum Datum des Widerrufs erhalten hat, sind im Normalfall mit einem Verzugszinssatz in Höhe von Basiszinssatz + 5 % zu verzinsen. Handelt es sich um ein grundpfandrechtlich gesichertes Verbraucherdarlehen (Verbraucher-Immobiliardarlehen), wird mit einem Verzugszinssatz in Höhe von Basiszinssatz + 2,5 % gerechnet. Am Ende werden die beiden Endbeträge gegeneinander aufgerechnet. Das Ergebnis ist der vom Darlehensnehmer abzulösende oder der vom Darlehensgeber zu zahlende Betrag.
Sollzins nach Sollzinsbindung
Unter Sollzins nach Sollzinsbindung versteht man den Zinssatz, zu dem ein Darlehen nach Ablauf der Sollzinsfestschreibung prolongiert (weitergeführt) wird. Die Höhe des Sollzinses nach Sollzinsbindung richtet sich nach den dann aktuellen Konditionen des Kapitalmarkts und ist insofern hypothetisch.
Der Sollzins nach Sollzinsbindung spielt eine Rolle, wenn über den vereinbarten Zeitraum der Sollzinsfestschreibung hinaus ein Tilgungsplan für ein Darlehen erstellt wird. Die Höhe des angenommenen Sollzinses nach Sollzinsbindung beeinflusst die zukünftige Ratenhöhe, die Gesamtlaufzeit und die Gesamtkosten des Darlehens bis zu seiner vollständigen Tilgung. Auch der Vergleichszins, die Bruttoausgaben, der Nettoaufwand und die Barwerte einer Berechnung ändern sich mit dem unterstellten Wert des Sollzinses nach Sollzinsbindung.
Der Kunde sollte daher beim Vergleichen von Finanzierungsangeboten auch die Höhe des Sollzinses nach Sollzinsbindung beachten. Das Angebot eines Kreditinstituts, das – im Interesse des Kunden, damit dieser nicht nach Ablauf der Sollzinsbindung eine böse Überraschung erlebt – einen höheren Sollzins nach Sollzinsbindung zugrunde legt, kann optisch teurer erscheinen, als das eines Konkurrenten, der mit einem niedrigen Sollzins nach Sollzinsbindung rechnet.
In der Software ALF-OPTIFI „Optimale Baufinanzierung“ sowie ALF-EFZ „Darlehen & mehr“ gibt es jeweils 3 Möglichkeiten den Sollzins nach Sollzinsbindung festzulegen:
- „Vorgabe“: Ein bestimmter Sollzinssatz nach Sollzinsbindung in % kann eingegeben werden – je nach Ihren Prognosen für die zukünftige Zinsentwicklung.
- „aus Effektivzins rechnen“: Das Darlehen wird so weiter gerechnet, als ob die aktuellen Konditionen weiterhin gelten würden. Dazu errechnet das Programm aus dem Effektivzins, der für den Sollzinsbindungszeitraum gilt, einen neuen Sollzinssatz. Hierbei werden alle Faktoren, die den Effektivzins des ursprüngliche Darlehens beeinflussen, weiter berücksichtigt (nicht nur der Sollzinssatz, sondern auch Disagio, Tilgungssatz, Art der Tilgungsverrechnung, Bearbeitungsgebühren usw.). Die bisherigen durchschnittlichen Kosten für den Kunden bleiben also gleich.
- „= Sollzinssatz“: Nach Sollzinsbindung wird einfach mit dem Sollzinssatz, der für den Sollzinsbindungszeitraum galt, weitergerechnet. Bei dieser Berechnungsmethode werden alle anderen den Effektivzins beeinflussenden Faktoren wie Disagio, Tilgungssatz, Art der Tilgungsverrechnung usw. nicht beachtet. Die durchschnittlichen jährlichen Kosten für den Kunden können sich also ändern.
Vollmacht
Unter Vollmacht versteht man die durch ein Rechtsgeschäft begründete Vertretungsmacht. Die Vollmacht entsteht durch einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung des Vollmachtgebers gegenüber dem Vertreter bzw., in Deutschland, wahlweise auch gegenüber dem Dritten. Unterschieden werden:
- Spezialvollmacht (zum Abschluss eines konkreten Rechtsgeschäftes)
- Generalvollmacht (zum Abschluss aller Rechtsgeschäfte, bei welchen Vertretung zulässig ist)
- Gattungsvollmacht (zum Abschluss sämtlicher Rechtsgeschäfte einer bestimmten Gattung oder Art)
- Vollmachten mit gesetzlich typisiertem Inhalt (z. B. Prokura und Handlungsvollmacht)
In Deutschland unterscheidet man auch zwischen Innenvollmacht (gegenüber dem Vertreter erklärte Vollmacht) und Außenvollmacht (gegenüber dem Dritten, dem gegenüber die Vertretung stattfinden soll, erklärte Vollmacht).
Zwangsversteigerung
Die Zwangsversteigerung (Subhastation) ist eine Zwangsvollstreckung im Vollstreckungsverfahren, das den Vorschriften der Zivilprozessordnung unterliegt. Das Zwangsversteigerungsverfahren ist im Zwangsversteigerungsgesetz gesetzlich geregelt.
Die Zwangsversteigerung ist die Durchsetzung eines Anspruchs mit staatlichen Machtmitteln. Der Gläubiger hat die Möglichkeiten, wegen einer Geldforderung in das unbewegliche Vermögen zu vollstrecken und seinen Anspruch somit zu befriedigen. Unbewegliches Vermögen sind Grundstücke und deren Aufbauten.
Der Antrag auf Anordnung der Zwangsversteigerung kann sowohl wegen eines dinglichen Anspruchs, beispielsweise aus einer Grundschuld oder Hypothek, als auch wegen eines persönlichen Anspruchs erfolgen. Wirtschaftlich sinnvoll ist bei vorhandenen Grundbuchbelastungen oft jedoch nur die àVersteigerung aus einer Grundschuld oder Hypothek aus der erstrangigen Belastung.
Eine besondere Form der Zwangsversteigerung ist die Teilungsversteigerung zur Aufhebung der Gemeinschaft.
Die Zwangsversteigerung führt – im Unterschied zur Zwangsverwaltung, die auf den Ertrag eines Grundstücks zielt – zu einer Verwertung der Immobilie.
Das Verfahren wird beim Amtsgericht als Vollstreckungsgericht durchgeführt. Dies wird als sachliche Zuständigkeit bezeichnet. Örtlich zuständig ist das Amtsgericht, in dessen Gerichtsbezirk die Immobilie liegt.
Die Zwangsversteigerung im Wege der Zwangsvollstreckung muss durch den Gläubiger beantragt werden. Der Rechtspfleger prüft, ob der Antrag ordnungsgemäß ist und die formalen Voraussetzungen für die Anordnung der Zwangsversteigerung vorliegen. Die Voraussetzungen hierfür sind die Vorlage eines Vollstreckungstitels, die ordnungsgemäße Vollstreckungsklausel sowie die Zustellung des Vollstreckungstitels. Im Grundbuch in Abteilung II wird vermerkt, dass die Zwangsversteigerung angeordnet ist.
Der Schuldner hat die Möglichkeit, die Einstellung der Zwangsversteigerung zu beantragen. Dieser Antrag hat Aussicht auf Erfolg, wenn der Schuldner nachweisen kann, dass er die Forderung des Gläubigers binnen sechs Monaten ausgleichen kann. In diesem Fall wird die Zwangsversteigerung für maximal sechs Monate eingestellt. Die Einstellung der Zwangsversteigerung kann das Gericht von Auflagen abhängig machen.
Der Rechtspfleger kann den Verkehrswert der Immobilie nach eigenem Ermessen schätzen. I. d. R. wird aber ein Sachverständiger mit der Erstellung eines Verkehrswertgutachtens beauftragt. Grundsätzlich kann auch ein vorhandenes Gutachten zur Verkehrswertermittlung dienen. Nach Anhörung der Beteiligten wird auf der Grundlage dieses Gutachtens der Verkehrswert durch Beschluss festgesetzt. Dieser Beschluss kann von allen Beteiligten mit der Beschwerde angefochten werden.
Nach erfolgter Verkehrswertfestsetzung wird der Versteigerungstermin bestimmt. In der Regel vergehen zwischen Anordnung der Zwangsversteigerung bis zur Bestimmung des Versteigerungstermins 9 bis 12 Monate, regional auch bis zum 24 Monate. Der Termin wird durch Aushang im Amtsgericht und Veröffentlichung im Amtsblatt bekannt gemacht. Zusätzlich erfolgt meist auch die Veröffentlichung in einer örtlichen Tageszeitung und immer häufiger im Internet.
Im Versteigerungstermin wird das „geringste Gebot“ aufgestellt. Es enthält die wegen vorrangiger Grundbucheintragung bestehen bleibenden Rechte und den bar zu zahlenden Teil. Die Mindestzeit, in der im Versteigerungstermin Gebote abgegeben werden können (Bietungszeit), beträgt 30 Minuten.
Der das Verfahren betreibende Gläubiger oder ein anderer dazu Berechtigter (z. B. der Schuldner), kann von jedem Bieter Sicherheitsleistung in Höhe von 10 % des Verkehrswerts verlangen. Diese Sicherheit wird oft bar geleistet. Es kann dazu aber auch ein von der Bundesbank bestätigter Scheck, ein Verrechnungsscheck, der von einem dazu zugelassenen Kreditinstitut ausgestellt ist, oder die Bürgschaftserklärung eines solchen Kreditinstitutes verwendet werden.
Liegt das beste abgegebene Gebot (Meistgebot) unterhalb 7/10 des Verkehrswertes, muss der Zuschlag versagt werden, wenn dies ein dazu Berechtigter beantragt. Liegt das Meistgebot unterhalb der Hälfte des Verkehrswertes, ist der Zuschlag von Amts wegen zu versagen. In beiden Fällen ist sofort ein neuer Versteigerungstermin zu bestimmen, in dem diese Grenzen nicht mehr gelten.
Der betreibende Gläubiger kann jederzeit, unabhängig von der Höhe des Gebots, die Einstellung des Verfahrens bewilligen. Das führt dann in der Regel ebenfalls zur Versagung des Zuschlags. Wird der Zuschlag erteilt, bestimmt der Rechtspfleger einen Verteilungstermin. In diesem wird der Versteigerungserlös nach einer gesetzlich vorgegebenen Rangfolge den Gläubigern zugeteilt.
Mit der Erteilung des Zuschlags geht das Eigentum auf den Meistbietenden über. Die erforderliche Berichtigung des Grundbuchs erstellt das Grundbuchamt auf Ersuchen des Versteigerungsgerichts.
Mehrdeutige Buchungen
Mehrdeutige Buchungen sind in ALF-BAS Kontenabstimmung offene Posten, die nicht eindeutig zuzuordnen sind. Dies trifft dann zu, wenn z. B. im Kontenbereich 1.000 EUR im Soll und im Gegenkontenbereich zweimal 1.000 EUR im Haben erfasst wurden. ALF-BAS kann den Betrag im Konto nicht eindeutig einer Gegenbuchung im Gegenkonto zuordnen. Durch eine Einbeziehung der Valuta kann die Anzahl der mehrdeutigen Buchungen i. d. R. verringert werden.
Offene Posten
Als offene Posten werden in ALF-BAS Kontenabstimmung alle erfassten Buchungen (auch Bewegungen, Umsätze) bezeichnet, die noch nicht abgeglichen wurden. Sie werden in Soll- und Haben-Posten unterschieden. Die Summe aller offenen Posten zuzüglich des Abgleichsaldos ergibt den Gesamtsaldo.
Schuldtitel
Das Vorliegen eines Vollstreckungstitels (auch Schuldtitel genannt) ist eine der Voraussetzungen für die Zulässigkeit der Zwangsvollstreckung.
Die wichtigsten Vollstreckungstitel sind Urteile, Beschluss, Vollstreckungsbescheid, Vergleich und vollstreckbare Urkunden. Aus welchen Vollstreckungstiteln die Zwangsvollstreckung betrieben werden kann, ergibt sich aus der Zivilprozessordnung.
Der Vollstreckungstitel muss bestimmt sein, das heißt, er muss die Parteien (Gläubiger und Schuldner) sowie Inhalt, Art und Umfang der geschuldeten Leistung genau bezeichnen.
Zwangsvollstreckung
Die Zwangsvollstreckung ist ein gesetzlich geregeltes Verfahren zur Durchsetzung der mit einem Vollstreckungstitel titulierten Ansprüche eines Gläubigers gegenüber einem Schuldner. Die Zwangsvollstreckung darf nur durch staatliche Stellen betrieben werden.
Zuständig sind dabei im Einzelnen:
- Gerichtsvollzieher zur Zwangsvollstreckung in körperliche Sachen
- Amtsgericht als Vollstreckungsgericht zur Zwangsvollstreckung in Forderungen und andere Vermögensrechte sowie für die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung von Grundstücken
- Vollstreckungsstelle der jeweils zuständigen Behörde (Innendienst und Vollziehungsbeamte)
- Grundbuchamt zur Eintragung einer Zwangshypothek
- Insolvenzgericht zur Gesamtvollstreckung.
Zu unterscheiden ist zwischen:
- Einzelzwangsvollstreckung (Befriedigung einzelner Gläubiger aus einzelnen Vermögensgegenständen des Schuldners)
- Gesamtvollstreckung (Befriedigung der Gesamtheit der Gläubiger aus allen Vermögensgegenständen des Schuldners im Rahmen eines Insolvenzverfahrens)
Voraussetzung der privaten Einzelzwangsvollstreckung ist für den Gläubiger ein Vollstreckungstitel, der dem Schuldner zugestellt und mit der Vollstreckungsklausel versehen sein muss.